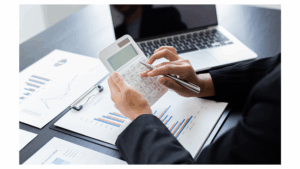Trusts wirken auf den ersten Blick wie elegante internationale Gestaltungsinstrumente. Aus deutscher Sicht sind sie jedoch ein rechtlicher Fremdkörper, dessen Behandlung im Steuerrecht einer komplexen Einzelfallprüfung gleicht.
Viele Mandanten merken schnell, wie schwierig die Übertragung eines Trusts in das deutsche Recht ist.
Im angloamerikanischen Rechtsraum sind Trusts ein etabliertes Instrument für Vermögensschutz, Nachfolgeplanung und steuerliche Gestaltung. In Deutschland hingegen gelten für Trust-Strukturen ganz eigene Regeln, die ihre Nutzung hierzulande zu einer echten Herausforderung machen.
Im Folgenden erhalten Sie einen kompakten Überblick zur steuerlichen Behandlung von Trusts in Deutschland und zu den wichtigsten rechtlichen und steuerlichen Fragen.
Warum gibt es in Deutschland keinen klassischen Trust?
Das deutsche Zivilrecht kennt das Institut des Trust nicht. Während im angloamerikanischen Recht das Vermögen zwischen rechtlichem Eigentümer (Trustee) und wirtschaftlich Berechtigten (Beneficiaries) aufgeteilt wird, gilt im deutschen Recht das Prinzip der Einheit des Eigentums.
Wer Eigentümer ist, dem stehen auch die wirtschaftlichen Rechte zu. Die gespaltene Rechtsinhaberschaft, wie sie für Trusts typisch ist, ist dem deutschen Recht fremd. Wer dennoch Trust-ähnliche Strukturen nutzen will, greift häufig auf Treuhand-Modelle oder Stiftungen zurück – allerdings mit erheblichem Anpassungsaufwand und rechtlichen Unsicherheiten.
Steuerliche Einordnung von Trusts
Das deutsche Steuerrecht kennt keine eigenständige Trust-Systematik. Stattdessen wird im Einzelfall geprüft, wie ein ausländischer Trust nach deutschen Maßstäben zu behandeln ist.
Ein Trust kann aus deutscher Sicht unter anderem qualifiziert werden als:
- Treuhand,
- Stiftung oder
- Zweckvermögen.
Diese Einordnung ist entscheidend für die steuerliche Behandlung – und kann von Struktur zu Struktur erheblich variieren.
Typische steuerliche Herausforderungen
Aus der Qualifikation des Trusts ergeben sich zahlreiche steuerliche Fragestellungen:
- Einkommensteuer: Die Zuordnung der Einkünfte hängt davon ab, ob der Trust steuerlich transparent oder intransparent behandelt wird. Bei Transparenz werden die Vermögenswerte dem Settlor oder den Beneficiaries zugerechnet.
- Erbschaft- und Schenkungsteuer: Auskehrungen aus dem Trust können sowohl der Einkommensteuer (§ 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG) als auch der Schenkungsteuer (§ 7 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 ErbStG) unterliegen. Für bestimmte Begünstigte gelten Ausnahmen.
- Grunderwerbsteuer: Überträgt ein Trust Immobilien, können grunderwerbsteuerliche Risiken entstehen, da das deutsche Recht Trusts nicht kennt und die Übertragung als steuerbarer Vorgang eingestuft werden kann.
- Melde- und Dokumentationspflichten: Trustees mit Deutschland-Bezug unterliegen umfangreichen Transparenzpflichten, insbesondere nach dem Geldwäschegesetz (GwG), dem Außensteuergesetz (AStG) sowie DAC6.
Schon kleine Unterschiede in der Ausgestaltung können zu völlig unterschiedlichen steuerlichen Ergebnissen führen – von der Durchgriffsbesteuerung bis zur umfassenden Steuerpflicht der Begünstigten.
Hoher Beratungsaufwand und laufende Überwachung
Weil es keinen klaren gesetzlichen Rahmen für Trusts gibt, ist praktisch jede Struktur eine Einzelfalllösung. Die Gefahr von Fehlqualifikationen und unerwarteten Steuerfolgen ist hoch.
Hinzu kommt: Änderungen im Ausland – etwa bei Satzung, Trustees oder Begünstigten – können sich unmittelbar auf die deutsche Besteuerung auswirken. Trust-Strukturen mit Deutschland-Bezug müssen daher laufend überwacht und bei Bedarf angepasst werden.
Fazit: Trusts bleiben ein Sonderfall
Trusts sind und bleiben in Deutschland ein rechtlicher und steuerlicher Sonderfall. Sie sind ein Fremdkörper im deutschen Rechtssystem und ihre Integration ist mit Unsicherheiten, hohem Aufwand und nicht zu unterschätzenden Steuerrisiken verbunden.
Für vermögende Privatpersonen und internationale Unternehmer kann ein Trust dennoch sinnvoll sein – vorausgesetzt, es gibt eine klare Strategie, eine saubere Dokumentation und eine enge steuerliche Begleitung.
Wichtige Punkte im Überblick:
- Keine zivilrechtliche Anerkennung klassischer Trusts in Deutschland.
- Steuerliche Behandlung erfolgt immer einzelfallbezogen, abhängig von Struktur und Ausgestaltung.
- Risiken bei Einkommensteuer, Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie Grunderwerbsteuer.
- Umfangreiche Melde- und Dokumentationspflichten.
- Hoher Beratungs- und Überwachungsaufwand.
Die Integration von Trust-Strukturen in deutsche Vermögens- und Nachfolgeplanungen erfordert daher eine besonders sorgfältige steuerliche und rechtliche Analyse.
Wenn Sie einen Trust besitzen, auflösen, als Erbe in einen bestehenden Trust „hineinwachsen“ oder eine internationale Struktur nach Deutschland überführen möchten, begleiten wir Sie gerne bei:
- der steuerlichen Einordnung Ihres Trusts,
- der Analyse von Risiken und Gestaltungsspielräumen,
- der Entwicklung rechtssicherer Alternativen,
- der Prüfung bestehender Trust-Strukturen sowie
- der steuerlichen Einordnung von Ausschüttungen und Vermögensübergängen.
Sprechen Sie uns an – wir unterstützen Sie zuverlässig und praxisnah.