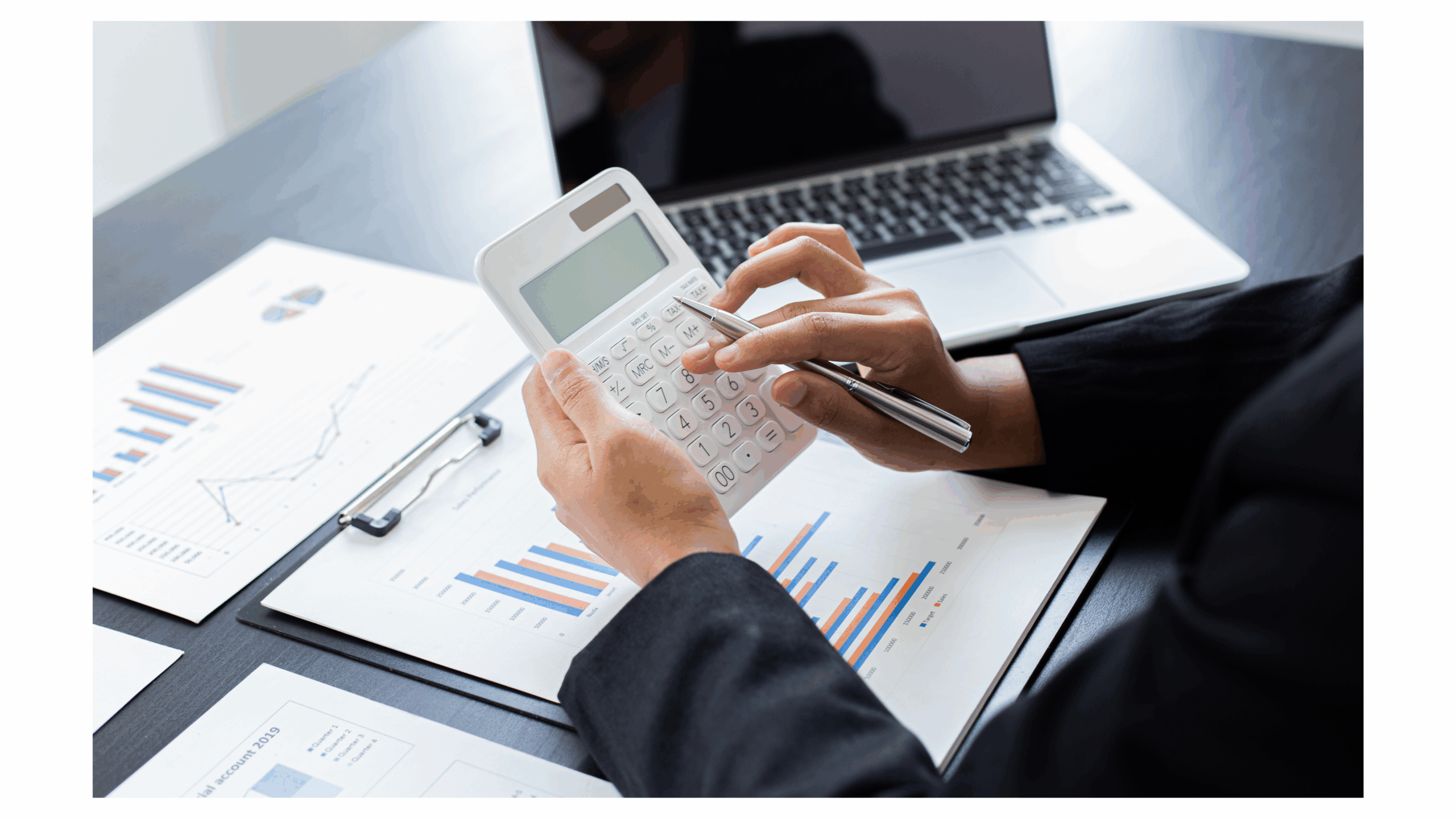Die Übertragung von selbstgenutzten Wohnungen oder Häusern (Familienheim) auf den Ehegatten oder auf Kinder wird durch § 13 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a bis c ErbStG besonders begünstigt. Hierbei sind insbesondere die Unterschiede zwischen dem Erwerb durch Erbfall und dem Erwerb durch Schenkung zu beachten.
Die Steuerbefreiung für das „Familienheim“ im erbschaftsteuerlichen Sinne bietet Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere wenn Familien ihren Lebensmittelpunkt verlagern.
Dabei werden die Voraussetzungen der Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a bis c ErbStG restriktiv ausgelegt, so dass streng darauf zu achten ist, dass die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung erfüllt sind.
Zu denken ist hier z.B. an die „unverzügliche“ Selbstnutzung, die Einhaltung der Behaltensfrist von 10 Jahren (im Erbfall) und die dafür erforderliche Nutzung als Familienheim sowie die zu vermutende Nichtbegünstigung von Gartengrundstücken.
Beispiel 1:
A ist alleiniger Eigentümer eines Zweifamilienhauses. Eine Wohnung (Wohnfläche 110 m²) bewohnt er zusammen mit seiner Ehefrau B. Die Einliegerwohnung (Wohnfläche 60 m²) ist zu fremden Wohnzwecken vermietet.
A überträgt B das hälftige Eigentum am gesamten Haus.
Die Übertragung des hälftigen Miteigentums ist zu zwei Dritteln (selbst genutzte Wohnung) als Familienheim steuerfrei und zu einem Drittel (vermietete Wohnung) zu 90 % steuerpflichtig (§ 13d ErbStG).
Familienheim und Kinder
Kinder sind als Erben des Familienheims nur bis zu einer Wohnfläche von 200 m² von der Erbschaftsteuer befreit. Dies gilt jedoch nur, wenn sie das Familienheim zehn Jahre nach dem Erbfall selbst nutzen. Auch eine Schenkung zu Lebzeiten ist nicht in gleicher Weise begünstigt wie unter Ehegatten. Nur durch die Vereinbarung eines Nießbrauchs kann eine steuerliche Begünstigung erreicht werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Gründung einer Familiengesellschaft.
Beispiel 2:
F verstirbt, ohne ein Testament zu hinterlassen. Zum Nachlass gehört ein selbstgenutztes Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 280 m². F hinterlässt ihren Ehemann M und ihr Kind K. Die Eheleute lebten im Güterstand der Zugewinngemeinschaft.
Nach der gesetzlichen Regelung erbt M die Hälfte und K die andere Hälfte. Damit geht das Familienheim zur Hälfte nach § 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG steuerfrei auf M und zur anderen Hälfte nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG steuerfrei auf K über – der Anteil von K beträgt 140 m². Nach Auffassung der Finanzverwaltung muss das Kind jedoch 80/280 des auf es entfallenden Werts des Hauses versteuern, da die Gesamtwohnfläche des Hauses mehr als 200 m² beträgt. Für den begünstigten Teil des Gebäudes muss das Kind, um die Steuerbefreiung dauerhaft zu erhalten, das Haus 10 Jahre lang selbst (mit)nutzen.